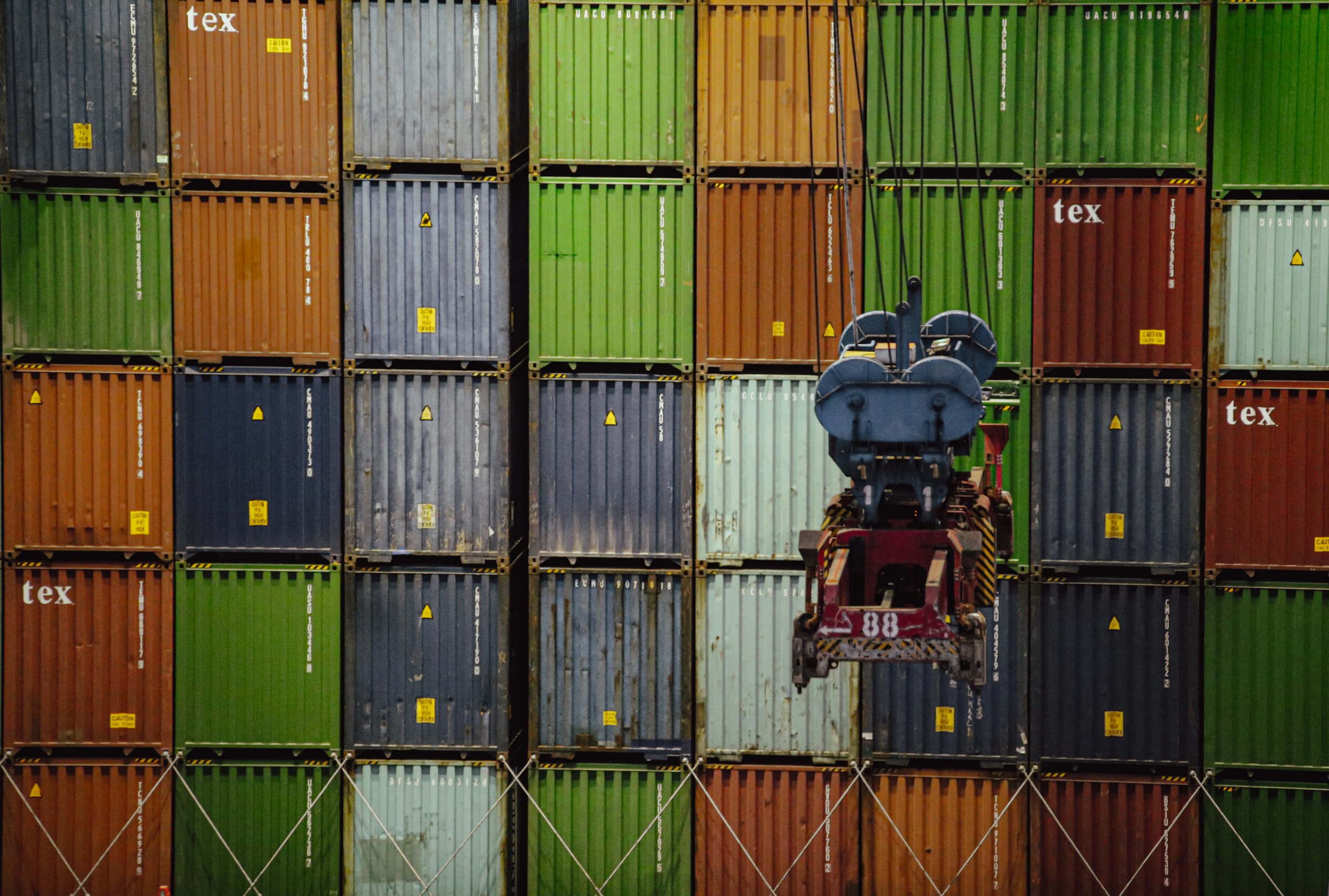 Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sind sich einig: Das Netto-Null-Ziel muss die Schweiz bis 2050 in erster Linie durch die Reduktion von CO2-Emissionen erreichen. Die Klimastrategie der Schweiz geht jedoch davon aus, dass ca. 12 Mio. Tonnen CO2eq nicht beziehungsweise schwer vermeidbare CO2-Emissionen trotz aller Verminderungsbemühungen verbleiben werden, welche es mit Technologien zur CO2-Abscheidung, Entnahme und Speicherung (nachfolgend der Einfachheit halber gesamthaft als «CCS-Technologien» bezeichnet) auszugleichen gilt. Während CCS-Technologien in der Schweiz bereits seit vielen Jahren erforscht werden und Schweizer Start-Ups bezüglich dieser Technologien teilweise führend sind, ist der Schweizer Gesetzgeber trotz dem ausgewiesenen Bedarf zögerlich, diese zu regulieren.
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft sind sich einig: Das Netto-Null-Ziel muss die Schweiz bis 2050 in erster Linie durch die Reduktion von CO2-Emissionen erreichen. Die Klimastrategie der Schweiz geht jedoch davon aus, dass ca. 12 Mio. Tonnen CO2eq nicht beziehungsweise schwer vermeidbare CO2-Emissionen trotz aller Verminderungsbemühungen verbleiben werden, welche es mit Technologien zur CO2-Abscheidung, Entnahme und Speicherung (nachfolgend der Einfachheit halber gesamthaft als «CCS-Technologien» bezeichnet) auszugleichen gilt. Während CCS-Technologien in der Schweiz bereits seit vielen Jahren erforscht werden und Schweizer Start-Ups bezüglich dieser Technologien teilweise führend sind, ist der Schweizer Gesetzgeber trotz dem ausgewiesenen Bedarf zögerlich, diese zu regulieren.
Dies ganz im Gegensatz zur EU, welche bereits 2009 mit der CCS-Richtlinie 2009/31/EG spezifische Mindestanforderungen für Vorhaben zur «Abscheidung und geologischen Speicherung von Kohlendioxid» in den Mitgliedstaaten aufgestellt hat. So braucht unter anderem jede CO2-Ablagerungsstätte eine Genehmigung; sie muss umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen treffen; die Behörden haben mindestens einmal jährlich Inspektionen durchzuführen; und nach Abschluss der CO2-Verpressung bleibt der Betreiber verantwortlich für mindestens 20 Jahre, danach kann unter gewissen Voraussetzungen die Verantwortung auf den Staat übertragen werden. Sodann regelt die CCS-Richtlinie die Haftung und sieht eine finanzielle Sicherheit und einen «Haftungsfonds» vor. Auch Deutschland hat auf Basis dieser CCS-Richtlinie ein Kohlendioxid-Speicherungsgesetz für die Erforschung, Erprobung und Demonstration der dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid in unterirdischen Gesteinsschichten (KSpG) erlassen, welches als lex specialis den abfallrechtlichen Regelungen vorgeht und sämtliche Verfahrensphasen von der Abscheidung, dem Transport, der dauerhaften Speicherung bis zur Stilllegung des Speichers regelt.
Die Einführung eines solchen Spezialgesetzes für CCS-Technologien wurde im Schweizer Parlament bisher noch nicht diskutiert. Weder im CO2-Gesetz noch in anderen Bundesgesetzen finden sich explizite Rechtsgrundlagen zur Erforschung und Anwendung von CCS-Technologien in der Schweiz. Wird heute in der Schweiz ein Projekt zur CO2-Abscheidung, Entnahme und Speicherung an die Hand genommen, so sind folglich die geltenden (Umwelt-)Erlasse anzuwenden, welche sich jedoch nur bedingt eignen, CCS-Technologien zu regeln. So stellt sich u.a. die Frage, ob das abgeschiedene bzw. der Atmosphäre technisch entzogene CO2 – sei es in gasförmigem oder flüssigem Zustand – als «Abfall» im Sinne von Art. 7 Abs. 6 USG zu qualifizieren ist, sodass das Abfallrecht auf den weiteren Umgang mit dem CO2 anwendbar wäre.
Mit der Teilrevision der CO2-Verordnung, welche der Bundesrat am 4. Mai 2022 gutgeheissen und rückwirkend auf Anfang 2022 in Kraft gesetzt hat, hat es der Gesetzgeber nun immerhin verstanden, Anreize für Investitionen in CCS-Technologien zu setzen, indem diese ins Schweizer Emissionshandels- (EHS) und Kompensationssystem integriert wurden. So lässt die CO2-Verordnung neu Kompensations-massnahmen zu, bei denen CO2 dauerhaft in biologischen (z.B. Wald und Böden) oder in geologischen (z.B. im Untergrund oder in Baustoffen) Speichern gebunden wird. Gemäss Art. 5 Abs. 2 CO2-Verordnung werden für solche Projekte und Programme, die CO2 speichern, Bescheinigungen ausgestellt, wenn die Anforderungen nach Art. 5 Abs. 1 CO2-Verordnung erfüllt sind und die Permanenz der Kohlenstoffbindung unabhängig von der Projektdauer bis mindestens 30 Jahre nach Wirkungsbeginn ausreichend sichergestellt ist. Durch den Verkauf solcher Bescheinigungen können Projekte zur CO2-Sequestrierung finanzielle Unterstützung erhalten.
Auch die nun dem Parlament überwiesene Revision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2024 will die CO2-Abscheidung und Speicherung weiter fördern, indem sie Investitionen in CCS-Technologien für EHS Anlagen attraktiver macht. So sollen neu Emissionsverminderungen durch Abscheidung und Speicherung von CO2 aus fossilen oder prozessbedingten Quellen angerechnet werden und die Pflicht zur Abgabe von Emissionsrechten für die dadurch verhinderten Emissionen wegfallen, wobei die Speicherung in einer unterirdischen Stätte im Europäischen Wirtschaftsraum erfolgen muss. Zudem soll auch die dauerhafte chemische Bindung von CO2 in langlebigen Produkten wie Baustoffen im EHS anrechenbar sein.
Das am 18. Juni 2023 angenommene Klima- und Innovationsgesetz (KIG) definiert den Begriff «Negativemissionstechnologien» zum ersten Mal auf Gesetzesstufe als «biologische und technische Verfahren, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und dauerhaft in Wäldern, in Böden, in Holzprodukten oder in anderen Kohlenstoffspeichern zu binden». Massnahmen, welche verhindern, dass Treibhausgase überhaupt in die Atmosphäre gelangen, wie zum Beispiel die Abscheidung von fossilen oder prozessbedingten CO2-Emissionen an der Quelle zählen gemäss dem Bericht der UREK-N vom 25. April 2022 zur «Verminderung von Treibhausgasemissionen». Art. 7 KIG macht sodann möglich, dass öffentliche Infrastrukturbauten, wie z.B. CO2-Pipelines oder geologische CO2-Speicher, finanziell unterstützt werden können, wenn diese für die Erreichung des Netto-Null-Ziels notwendig sind.
Um einen sicheren und schweizweit einheitlichen Umgang mit CCS-Technologien sicherzustellen und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, reichen finanzielle Anreize und gesetzliche Definitionen jedoch nicht aus. Sollen national sinnvolle und mit der EU abgestimmte Netze an CO2-Transportleitungen erstellt werden, wäre es nötig, dass der Bund diesbezüglich die Federführung, Regulierung und Verantwortung übernimmt. Betreffend CO2-Speicherung müsste in Bundeserlassen normiert werden, welchen Anforderungen die dauerhafte Lagerung von CO2 im Untergrund zum Schutz von Mensch und Umwelt zu genügen hat, wie die Suche nach geeigneten Speicherstätten zu koordinieren ist und welche Rahmenbedingungen hinsichtlich Bewilligung und Zuständigkeit für die Verbringung von abgeschiedenem CO2 ins Ausland zwecks dortiger Speicherung gelten sollen. Auch eine regelmässige Kontrolle von und Berichterstattung über CCS-Projekte(n) sollte gesetzlich verankert und eine explizite Haftungsnorm für Fälle von Leckagen und anderen Unfällen eingeführt werden.
Durch eine proaktive Legiferierung mittels sachspezifischer Ergänzungen in bestehenden Erlassen oder einer in sich geschlossenen «CCS-Gesetzgebung» würde der Gesetzgeber sicherstellen, dass der Umgang mit CCS-Technologien gesellschaftlich diskutiert, politisch gefestigt und angemessen reguliert wird, damit diese Technologien ihren wichtigen Beitrag für das Netto-Null Ziel 2050 tatsächlich leisten können. Ein Hinterherhinken des Rechts und ein unkoordiniertes Vorgehen der verschiedenen Akteure sollte aufgrund der grossen Chancen, aber auch Risiken von CCS-Technologien unbedingt vermieden werden.
von Rahel Zimmermann, MLaw, Ecosens AG, Wallisellen, und Lorenz Lehmann, lic. iur., Rechtsanwalt, Ecosens AG, Wallisellen
Dieser Blogbeitrag basiert auf dem Artikel URP 2023 465
Foto von Bernd 📷 Dittrich auf Unsplash



